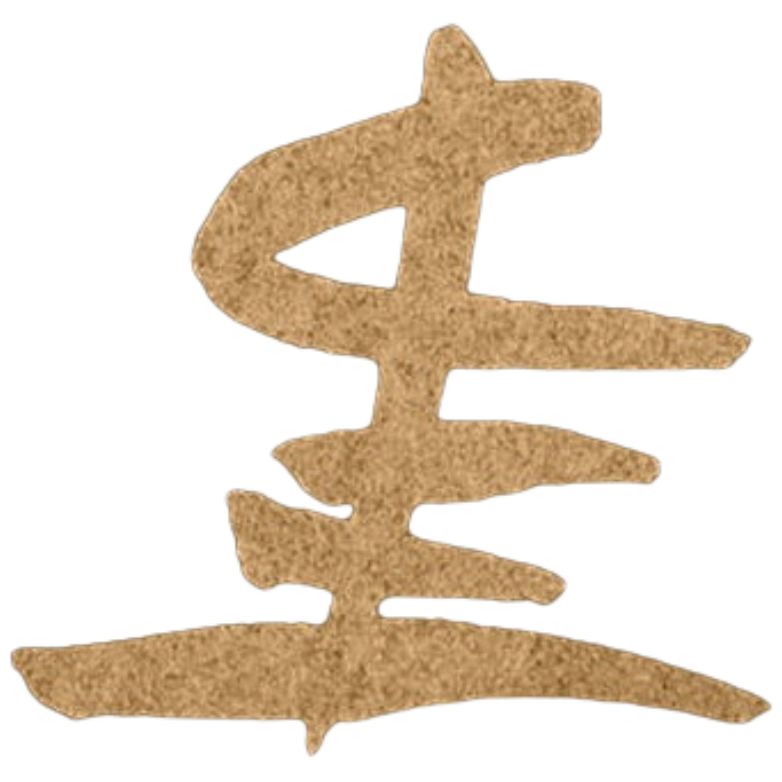Wenn ich den Ofen öffne und ein glühend rotes Stück herausziehe, fühlt es sich lebendig an. Die Luft beißt in die Oberfläche, und die Farben verändern sich in Sekunden. Manchmal tiefschwarz, manchmal schwarz mit rötlich-braunen Schattierungen, manchmal etwas völlig Unerwartetes.
Ich habe mit dieser Technik begonnen, weil sie mir genau das gibt, was ich will – ohne Kompromisse: eine tiefschwarze Glasur, ganz ohne Mangan oder künstliche Farbstoffe. Ich verwende nur Eisenoxid und Asche. Das Geheimnis liegt im Abkühlen. Wenn Eisen schnell abgekühlt wird, färbt es sich schwarz. Genau das ermöglicht Hikidashi.

Mein Ofen ist kein traditioneller Holzofen. Es ist ein von mir veränderter, oben zu ladender Elektroofen. An der Seite habe ich einen Gasbrenner eingebaut und durch ein Guckloch schiebe ich dünne Holzstücke hinein. Auf dem Deckel habe ich ein Rohr angebracht, damit die Gase entweichen können. Diese kleinen Veränderungen wecken das Feuer. Sie bringen Bewegung und Rauch – etwas, das reine Elektrohitze nicht geben kann.
Hikidashi ist alt. Es entstand in Japan während der Momoyama-Zeit, vor mehr als 400 Jahren. Töpfer in der Nähe von Seto und Mino entdeckten es zufällig. Sie zogen Stücke aus dem Ofen, um die Reife der Glasur zu prüfen – und das nicht nur kleine Proben, sondern ganze Schalen. Die Luft veränderte die Glasur, und das entstandene Schwarz wurde berühmt als Seto-guro. Später folgte der kühne Pinselstrich der Kuro-Oribe.
Ein Name steht hinter diesem Geist: Furuta Oribe. Ein Teemeister, der Überraschung und Freiheit liebte. Er forderte die Töpfer auf, Regeln zu brechen, Schönheit dort zu suchen, wo andere Fehler sahen. Hikidashi war die perfekte Antwort – eine Methode, bei der durch den plötzlichen Kontakt mit kalter Luft oder Wasser die Glasur erstarrt, als würde man die Ewigkeit in einem einzigen Moment festhalten.
Oft wird Hikidashi mit Raku verglichen. Sie wirken ähnlich, sind aber verschieden. Hikidashi-Stücke werden bei höheren Temperaturen herausgezogen – etwa 1260 °C. Bei dieser Temperatur ist der Ton, den ich verwende, vollständig gesintert und stark. Dennoch überleben manchmal mehr als die Hälfte der Gefäße nicht, weil sie dem extremen Temperaturunterschied ausgesetzt sind – einige werden sogar direkt ins Wasser getaucht. Ich mache diese Technik hauptsächlich für Chawan und Yunomi, die auch tatsächlich für den Teegebrauch bestimmt sind. Das ist mir wichtig: Schönheit und Funktion zusammen.
Ich halte auch an der alten Gewohnheit fest, ganze Stücke zu testen. Das ist nicht billig, aber es lehrt mehr, als es eine Probe jemals könnte. Man sieht, wie Fuß, Wände und Glasur – alles – in einem lebendigen Körper miteinander reagieren. Das mache ich auch in meinem anderen Gasofen.
Lucian Chiuia
Ich bin Lucian Chiuia – Töpfer seit über 30 Jahren. In meiner Werkstatt in einer alten Scheune in Bockenheim fertige ich Gebrauchskeramik, die Spuren trägt: vom Feuer, von der Hand, vom Moment. Ich arbeite mit Gas und Holz, mische meine Tone selbst und lasse jedes Stück seinen eigenen Weg finden. Kein Massenprodukt – sondern ehrliche, lebendige Gefäße, die still sprechen.
Ein Stück hat dich angesprochen? Schreib mir →